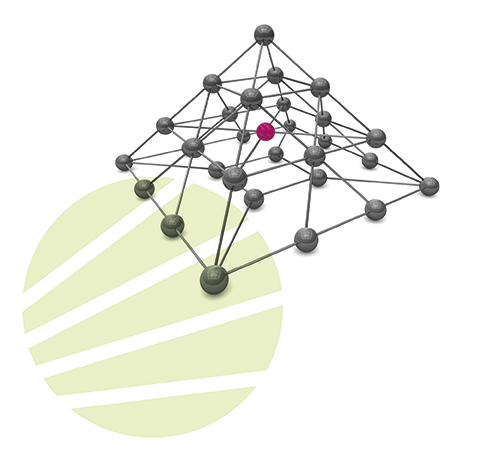Veranstaltungen
„Duckmäusertum in der schwarzen Berufsverbots-Provinz“? Der „Radikalenerlass“ von 1972 in Baden-Württemberg – Vorbedingungen, Umsetzung und Wirkungsgeschichte am 11. Februar 2026
Mittwoch, 11. Februar 2026, 18–20 Uhr
Ort: Campus Karlsruhe der FernUniversität, Kriegsstraße 100 (2. OG), 76133 Karlsruhe, Seminarraum ELSASS Online-Zugang: siehe unten.
Vortrag von Mirjam Schnorr M. A.
Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fritz-Bauer-Institut, Frankfurt a. M.
2026 jährt sich zum 35. Mal der Beschluss der baden-württembergischen Landesregierung von 1991 zur Abschaffung der Regelanfrage beim Verfassungsschutz auf Grundlage des „Radikalenerlasses“. Dieser war im Januar 1972 unter Bundeskanzler Willy Brandt ausgearbeitet worden, um potentiell Rechts- und Linksradikale, sog. Verfassungsfeinde, aus dem öffentlichen Dienst fernzuhalten. Im Südwesten hatte seit 1973 eine eigene Variante des „Radikalenerlasses“ bestanden, der „Beschluß der Landesregierung über die Pflicht zur Verfassungstreue im öffentlichen Dienst“ – inoffiziell auch „Schiess-Erlass“ genannt, nach dem Innenminister Karl Schiess (Amtszeit 1972–1978).
Mit den durch den „Schiess-Erlass“ eingeführten Regelungen zur Aufnahme und Beschäftigung im öffentlichen Dienst galt Baden-Württemberg als CDU-geführte „schwarze Berufsverbots-Provinz“, weil hier besonders hartnäckig gegen „Radikale“ vorgegangen wurde. Insgesamt betrieb die Landesregierung allerdings unter Einbezug des Verfassungsschutzes nur einen unverhältnismäßig hohen bürokratischen Aufwand, der beinahe ausschließlich den beruflichen Werdegang vor allem junger Linker beeinträchtigte. Die individuellen Folgen für die Betroffenen des „Radikalen“- und „Schiess-Erlasses“ waren zum Teil schwerwiegend, und im gesamtgesellschaftlichen Rahmen überwog eher der Eindruck von „Duckmäusertum“ und Verunsicherung als von effektivem Schutz der Demokratie mittels der Bekämpfung von Extremismus.
Der Vortrag skizziert die Geschichte des „Radikalenerlasses“ im Südwesten und fragt dabei nach seinen regionalen Besonderheiten. Ein Augenmerk liegt dezidiert auf der Veranschaulichung von Fallbeispielen aus dem badischen Raum, um die Perspektive der Betroffenen mit aufzunehmen.
Mirjam Schnorr M. A., geboren 1989, Historikerin, war von 2018 bis 2021 Mitarbeiterin im Heidelberger Forschungsprojekt „Verfassungsfeinde im Land? Baden-Württemberg, ’68 und der ‚Radikalenerlass‘ (1968–2018)“. Aktuell ist sie am Fritz Bauer Institut in Frankfurt am Main beschäftigt. In ihrer Dissertation hat sie Alltags- und Verfolgungserfahrungen von Prostituierten und Zuhältern im NS-Staat untersucht.
Die Veranstaltung wird hybrid durchgeführt; es ist keine Anmeldung erforderlich:
Für die Online-Teilnahme:
Zoom-Zugangslink: https://e.feu.de/gespraeche-in-zoom
Meeting-ID: 852 7280 4600
Kenncode: 80696338
Für die Teilnahme in Präsenz kommen Sie bitte auf dem Campus Karlsruhe der FernUniversität in den Seminarraum ELSASS (Adresse siehe oben).
Eine ausschnittweise Aufzeichnung der Veranstaltung wird zeitnah – auch mit Möglichkeit zur nachträglichen Kommentierung oder Rückmeldung an den Referenten – im Veranstaltungsrückblick veröffentlicht.
Von rücksichtslosen Ausbeutern und freundlichen „Ariseuren“ – die „Arisierung“ im Vergleich zwischen der Großstadt Karlsruhe und den Ortenauer Landgemeinden Kippenheim/Schmieheim am 11. November 2026
Mittwoch, 11. November 2026, 18–20 Uhr
Ort: Campus Karlsruhe der FernUniversität, Kriegsstraße 100 (2. OG), 76133 Karlsruhe, Seminarraum ELSASS Online-Zugang: siehe unten.
Vortrag von Dr. Marco Wottge
Zeithistoriker, Lehrer für Geschichte und Ev. Religion
Anlässlich des 88. Jahrestags der Reichspogromnacht vom 9. November 1938 nimmt die Veranstaltung den Vorgang der sog. „Arisierung“ im badischen Raum in den Blick. Mindestens 400 Grundstücke, über 1.000 Firmen und unzählige Wertgegenstände, welche jüdischen Bürgern in Karlsruhe gehörten, gingen zwischen 1933 und 1945 zwangsweise in „arische“ Hände über. Dieser als „Arisierung“ bezeichnete Prozess zählt nicht nur in Karlsruhe, sondern deutschlandweit zu den größten Enteignungsprozessen in der Geschichte.
Im Mittelpunkt des Vortrages steht die These, dass die wirtschaftliche Ausschaltung und Ausbeutung jüdischer Bürger in der Großstadt Karlsruhe radikaler verlief als in den Landgemeinden Kippenheim und Schmieheim. Die vergleichende Betrachtung der Ortenau und Karlsruhes lässt nicht nur die politischen Entscheidungsträger in den Blick treten, sondern veranschaulicht gleichfalls die Handlungsspielräume der örtlichen Bevölkerung.
Einen vorläufigen Höhepunkt im „Arisierungsprozess“ markierte die Reichspogromnacht am 9. November 1938. Sie offenbart zudem wie unter einem Brennglas die Unterschiede zwischen Stadt und Land. Am Ende des Vortrages steht die Frage, welche „Medizin“ am besten gegen antisemitische Propaganda hilft?
Dr. phil. Marco Wottge, geb. 1984, erhielt 2015 ein Promotionsstipendium der Stadt Karlsruhe, um die „Arisierung“ in Karlsruhe zu erforschen. In mehreren Publikationen setzte er sich seither mit der „Arisierung“ in Stadt und Land auseinander. Aktuell unterrichtet er als Realschullehrer in Schleswig-Holstein Geschichte und evangelische Religion.
Die Veranstaltung wird hybrid durchgeführt; es ist keine Anmeldung erforderlich:
Für die Online-Teilnahme:
Zoom-Zugangslink: https://e.feu.de/gespraeche-in-zoom
Meeting-ID: 852 7280 4600
Kenncode: 80696338
Für die Teilnahme in Präsenz kommen Sie bitte auf dem Campus Karlsruhe der FernUniversität in den Seminarraum ELSASS (Adresse siehe oben).
Eine ausschnittweise Aufzeichnung der Veranstaltung wird zeitnah – auch mit Möglichkeit zur nachträglichen Kommentierung oder Rückmeldung an den Referenten – im Veranstaltungsrückblick veröffentlicht.
Verdrängt, verfolgt, vernichtet: die NS-Verfolgung von Sinti und Roma in Baden. Ein Werkstattbericht im Spiegel der Quellen am 17. Juni 2026
Mittwoch, 17. Juni 2026, 18–20 Uhr
Ort: Campus Karlsruhe der FernUniversität, Kriegsstraße 100 (2. OG), 76133 Karlsruhe, Seminarraum ELSASS Online-Zugang: siehe unten.
Vortrag von Johannes Kaiser M. A.
Doktorand an der Universität Heidelberg
Mehrere hunderttausend Sinti und Roma wurden während des Nationalsozialismus in Europa ermordet. Doch schon lange vor 1933 waren Sinti und Roma systematisch ausgegrenzt und verfolgt worden – gesellschaftlich wie staatlich. Diese jahrhundertelangen Praktiken führten zu einem Sonderrecht, das den Boden für den späteren Genozid bereitete.
Wie vollzog sich diese Entwicklung in Karlsruhe und Baden? Bereits in der Weimarer Republik hatte sich ein repressives Vorgehen gegen Sinti und Roma etabliert. Dabei prallten unterschiedliche Interessen aufeinander: Während das Land Baden auf „Sesshaftmachung“ setzte, forderten viele Kommunen eine konsequente Vertreibung. Diese gegensätzlichen Strategien wurden auf dem Rücken der Betroffenen ausgetragen – und nach 1933 zunächst nahtlos fortgeführt. Die nationalsozialistische Rassenpolitik verschob den Kurs in den späten 1930er-Jahren deutlich in Richtung radikaler Verfolgung.
Die archivalische Überlieferung zu diesem Themenfeld ist ebenso vielfältig wie fragmentarisch: Sie reicht von Hinweisen auf gezielte Aktenvernichtungen mit entsprechenden Lücken bis hin zur umfangreichen Dokumentation von Deportationen. In seinem Werkstattbericht bietet der Referent Einblicke in ausgewählte Quellenfunde und reflektiert die Herausforderungen beim Umgang mit dem historischen Material.
Johannes Kaiser M. A., geb. 1991, studierte Geschichte und Philosophie an der Universität Heidelberg und schloss 2019 mit dem Master of Arts in Geschichte ab, seit 2021 promoviert er zur nationalsozialistischen Verfolgung von Sinti und Roma in Baden an der Universität Heidelberg; 2018/19 Tätigkeit in verschiedenen Funktionen am Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma (Heidelberg) und beim Zentralrat Deutscher Sinti und Roma (ebendort), 2020–2024 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma.
Die Veranstaltung wird hybrid durchgeführt; es ist keine Anmeldung erforderlich:
Für die Online-Teilnahme:
Zoom-Zugangslink: https://e.feu.de/gespraeche-in-zoom
Meeting-ID: 852 7280 4600
Kenncode: 80696338
Für die Teilnahme in Präsenz kommen Sie bitte auf dem Campus Karlsruhe der FernUniversität in den Seminarraum ELSASS (Adresse siehe oben).
Eine ausschnittweise Aufzeichnung der Veranstaltung wird zeitnah – auch mit Möglichkeit zur nachträglichen Kommentierung oder Rückmeldung an den Referenten – im Veranstaltungsrückblick veröffentlicht.